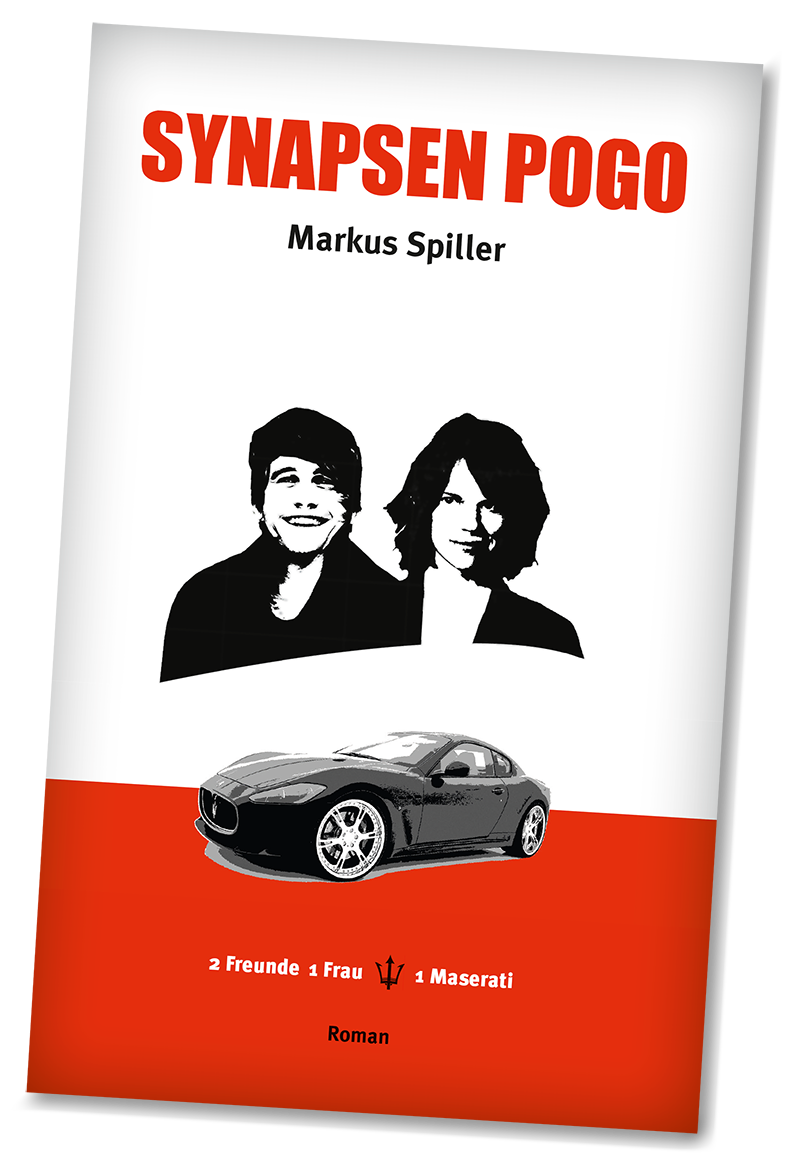Synapsen Pogo - LESEPROBE 1
☆ Seite 6-10 ☆
Wir befanden uns im Weißen Haus, Washington, D.C. Schlaue Strategen hatten einen Plan ausgetüftelt, der uns immer wieder eingetrichtert worden war. Ich fand ihn eher profan, typisch amerikanisch. Er bestand darin, in einem genau festgelegten Augenblick der Bedrohung eine temporäre Sicherheitszone aufzusuchen. Diese nannte sich Dead Spot, eine Art toter Winkel, die es überall im Gebäude gab. Wenn also jemand von außen durch Fenster oder Türen drang, konnte er keine der Personen im Gebäudeinneren sehen, soweit sich diese in einem Dead Spot befanden. Dem Angreifer erschien das Gebäude leer. Nur bei weiterem Vordringen und genauerem Suchen konnte man die Menschen aufspüren, die dadurch wertvolle Sekunden für lebenserhaltende Maßnahmen gewannen. So weit die grobe Theorie. Die prunkvolle Architektur des Gebäudes war so optimal wie möglich in das Sicherheitskonzept integriert worden, doch an einen Schutz gegen Terroristen hatte man bei der Erbauung nur unzureichend gedacht. Die Priorität lag eindeutig auf repräsentativen Funktionen. Das würden wir nun ausbaden müssen, denn irgendwelchen Aggressoren war es gelungen, an Sicherheitskräften, modernen Kameras und Sensoren vorbei und tatsächlich bis ans Gebäude heranzukommen. Ich erschrak, als ich ein Fenster splittern hörte und ein kleiner, aber schwerer, metallischer Gegenstand auf den Boden krachte. Er sah aus wie eine Urne, hoffentlich war das nicht symbolträchtig. Zeitgleich setzte MG-Feuer ein. Der Five to Zero trat in Kraft. Besagter Notfall-Plan, dessen Ablauf ich runterbeten konnte und den wir seit meiner Ausbildung wohl einige hundert Mal trainiert hatten. Trotz Schock war er präsent, trotz schwer zu kontrollierender Hysterie konnte er abgerufen werden. Er galt für alle im Gebäude Anwesenden und gebot verschiedene Verhaltensmaßnahmen, abhängig davon, ob man sich im Kino, im Grünen Saal oder auf der Bowling-Bahn befand. Richtlinien, um zu überleben. Ich ließ mich instinktiv fallen und rollte über den Boden, um mich hinter einem kleinen Mauervorsprung wieder aufzurichten. Hier stand ich also zitternd in meinem Dead Spot und hatte Schweißausbrüche. Es war Sommer und sowieso schon unglaublich heiß. Die Kleidervorschrift erlaubte lediglich schwarze Jeans und ein schwarzes, kurzärmeliges Hemd als Zugeständnis an die glühend heißen Temperaturen. Mein Herz schlug heftig, die unterdrückte Panik fühlte sich an, als ob in meinem Magen ein Feuerball aufgepumpt wurde. Ich versuchte zu denken und brüllte mir innerlich selbst Fragen zu: Wie weit ist es bis zum Ostbunker? Wie weit zu einem der insgesamt acht Treppenhäuser? Die Zeit würde nicht reichen. Hinter einer Couch sah ich Christa, die Chefsekretärin des Weißen Hauses. Sie sah mit weit aufgerissenen Augen flehend zu mir, hatte genauso viel Angst wie ich. Ihr Versteck war kein offizieller Dead Spot. Was soll‘s, wenn die Terroristen es erst geschafft hatten, die Jungs vom Secret Service plattzumachen, waren wir sowieso leichte Beute. Der Präsident musste irgendwo im Raum sein, genauso wie Senator Basher, ein einflussreicher, parteinaher Kollege, mit dem er gerade vom Golfplatz zurückgekehrt war. Sein letzter Termin heute, er wollte das Gebäude nicht mehr verlassen. Die Killer schienen das zu wissen, waren offensichtlich gut informiert. Immer wieder splitterten Scheiben und vereinzelte Salven rasselten ohrenbetäubend durch den Raum. Dazwischen hörte man nichts bis auf das dumpfe Aufschlagen weiterer kleiner Urnen, die anscheinend durch die Fenster ins Haus geworfen wurden und nun heftig anfingen zu rauchen. Von den Angreifern selbst war nichts zu sehen. Ich hörte Basher, der irgendetwas rief. Seine Stimme erstarb jäh, ungefähr zu dem Zeitpunkt, als ich ein heftiges Kratzen in meiner Luftröhre verspürte. Auch durch Nase und Stirnhöhlen zog sich schlagartig ein aggressives Brennen, das sich in Kopf und Lungen fortsetze. Ich wollte die Luft anhalten, musste aber sofort husten, wodurch ich automatisch mehr von dem ätzenden Rauch einsog. Ich sah rüber zu Christa, sie kniete auf dem Boden, röchelte und hielt sich mit beiden Händen den Hals. Mein Gott, ihre Augen sahen aus wie auf vierfache Größe aufgepumpt und zwischen ihren Fingern sprudelte Blut hervor. Ich hatte das Gefühl bei lebendigem Leib zu verbrennen und fasste instinktiv nach meinem Hals. Ich ertastete nur noch klebrige Sehnen und sich auflösende Gewebefetzen, wobei ich die Adern kaum mehr von einer etwas größeren, blutverklebten Röhre unterscheiden konnte. Dann verlor ich das Bewusstsein …
Als ich hustend wieder zu mir kam, lag ich mit dem Kopf auf der Tastatur und brauchte ein wenig, um meine reale Umgebung zu begreifen. Keine chemische Kriegsführung, kein Blut. Es war Mittwochnachmittag und ich war in meiner Bude, Gott sei Dank. Alles war gut, bis auf diesen blutigen Traum, der mich etwas aus der Bahn warf. Wieso träumt man manchmal eigentlich so einen Mist?
Es war heiß, und das ungewöhnlicherweise schon seit Wochen. Kein Wunder, dass bei dem Wetter die Polarkappen schmolzen, dachte ich. Im Allgemeinen hielt sich ein Altbau lange kühl, aber in meiner Dachgeschosswohnung wäre jedes Hoffen naiv gewesen. Mit Einbruch der Hitzewelle entstand hier in Echtzeit Saunastimmung. Unter dem Vorwand einer dringenden Abkühlung hatte ich mir bereits am Nachmittag einen Caipirinha gemixt. Beim zweiten konnte ich mich kaum noch auf das Tippen konzentrieren. Ein Anfall von Müdigkeit besorgte den Rest. Ich erhob mich vom Schreibtisch und sah beiläufig in den Spiegel. Meine rechte Gesichtshälfte gab den Abdruck der Tastatur wieder. Die Enter-Taste umspielte fröhlich einen Mundwinkel. Ich tauschte meine Shorts gegen eine kurze No-Name-Sporthose, geriet ins Straucheln und stieß mir den Kopf an der Dachschräge. „Scheiße!“ Ich griff nach meinem Glas und trank den letzten, eklig warmen Schluck Caipirinha. Quasi gegen den Schmerz. Dann schlurfte ich das Treppenhaus hinab. Draußen war es tatsächlich ein paar Grad kühler als in meiner Wohnung. Ich steuerte den Kiosk an. Der Albaner, der hier meistens auf der anderen Seite des Tresens hing, war nicht wirklich mit den Floskeln der Kommunikation vertraut, weshalb auf mein „Hallo“ auch
nichts zurückkam. Ich wiederholte meinen Gruß, diesmal unter Einsatz mehr Stimmvolumens: „Haaaalloooo.“ Etwas überrascht schaute er mich aus seinen großen schwarzen Augen an und entgegnete ein „Gutes Tag, was kann ich für Sie tun?“. Wieso er nach der ganzen Zeit immer noch „Sie“ zu mir sagte, verstand ich nicht. Zumal meine Erscheinung nicht besonders Respekt einflößend war. Ich trug Adiletten, Shorts und hatte keine Scham, meinen derzeit etwas untertrainierten Oberkörper nackt durch die Gegend zu schieben. Mein Schädel wummerte und ich hatte das Gefühl, dass sich die zwei Kilo Rohrzucker aus dem Caipirinha direkt auf meiner Hirnrinde abgesetzt hatten. Ich nahm zwei Flaschen Mineralwasser aus dem riesigen Glaskühlschrank, bat um eine Schachtel Zigaretten, die er hinter sich aus dem Regal fischte und legte ihm zehn Euro auf den Verkaufstresen. Es gab kaum Wechselgeld. Mann, wann war das eigentlich alles so teuer geworden? Ich verließ den Laden und rief „Tschö“. Wie gewohnt fiel ein Gruß seitens meines Kollegen weg.
In meiner Wohnung, eine eher unaufgeregte Mischung aus Ikea und Möbel-Lager-Süd, verspürte ich wenig Lust, weiter am Rechner zu arbeiten. Ich trank herrlich erfrischendes Mineralwasser und erfreute mich an einem Maximum an Kohlensäure. Meine interaktiven Handlungen reduzierte ich auf ein Minimum, rief nur noch kurz die E-Mails ab. „Viagra“ hatte es in den Posteingang geschafft, war trotz Spam-Filter durchgekommen und nervte. Löschen. Und woher die Freaks, die mir den Kauf von Solartechnik-Wertpapieren schmackhaft machen wollten, meine Adresse hatten, wusste ich auch nicht. Fast hätte ich eine Mail von meiner alten Freundin Suse übersehen. Ihr kleiner Sohn war heut Abend in der Obhut seines Vaters, ihrem Ex. Dadurch bot sich die Gelegenheit, mal in der einen oder anderen Bar vorbeizuschauen. Da ich für den Abend nix geplant hatte, sagte ich zu und schrieb ihr, dass ich mich später melden würde. Bis dahin würde ich die Zeit schon irgendwie totschlagen.
Ich hätte schwimmen gehen können, doch allein machte das nicht so viel Spaß. Besonders wenn alle anderen arbeiteten. Beim Gedanken an meine Freunde bekam ich ein schlechtes Gewissen. Ich stellte mir vor, wie sie gerade an ihrer Karriere schraubten, sich unentbehrlich machten und wahnsinnig produktiv waren. Wie konnte ich da in der Sonne liegen und einfach nichts tun? Mein Kopf kam mir derzeit vor wie eine fruchtlose Steppenlandschaft, die öde Oberfläche eines weit entfernten Planeten, der schon ewig darauf wartete, erschlossen zu werden. Meine Kreativität war auf dem Nullpunkt, absolute Windstille.